
Bleistiftarbeiten

| 3 Farbstift-Arbeiten: | ||
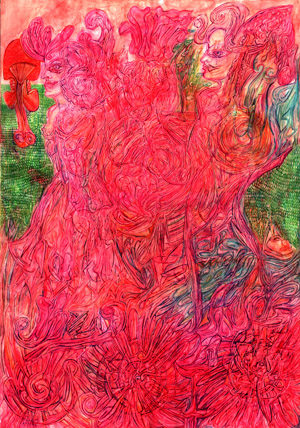 |
 |
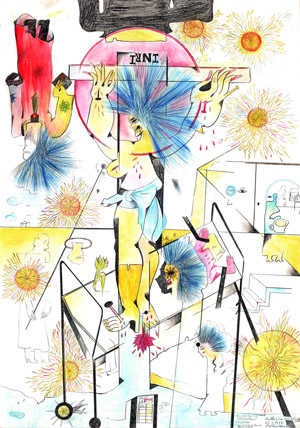 |
 |
 |
 |
 |
 |
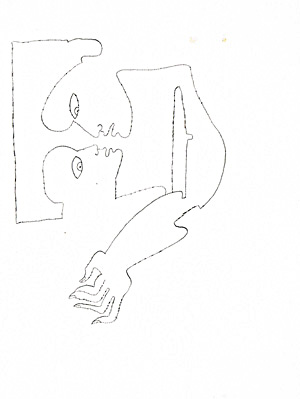 |
 |
 |
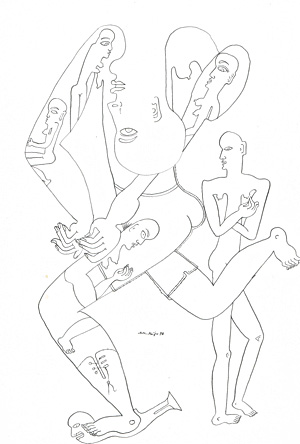 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
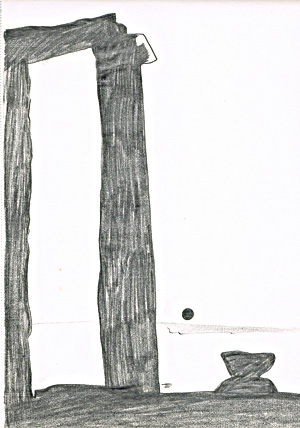 |
 |
 |
Hans-Jürgen Döpp
Das gezeichnete Ich
|
 |
- Zu den Zeichnungen von Martina Kügler –
In seinen „Spielregeln der Kunst“ beobachtet der
Schriftsteller Alain einen Pianisten beim Spiel, der dafür bekannt war, dem
Beethoven der letzten drei Sonaten ähnlich zu sein. „Er begann mit einem
rhythmisierten Tumult, der sozusagen das Material heranschaffte, das dann
geordnet und entwickelt wurde; und er endete mit jener verhaltenen Bewegung, in
der selbst die Pausen zu reden anfangen, der Rhythmus sich auflöst, die Zeit
entlassen wird und stillsteht“.
Vor allem Anfang steht das Tohuwabohu, das Chaos. Die
Schöpfung beginnt mit dem Nichts. Für den Künstler: das Nichts des leeren,
weißen Blattes.
Wiederholt sich nicht in jeder künstlerischen Kreation
der Schöpfungsakt? Wie der Gesang dem Geräusch, so entsteigt die Zeichnung dem
Chaos eines „Gekritzels“.
„Ich verzeichne das Papier“, bemerkte Martina Kügler zu
ihrem Arbeitsprozess. Am Anfang war der willkürliche Strich, der die Leere
vernichten soll. Das Nichts wird aufgeschreckt, attackiert die Spur eines
fremden Willens, und nur allzuleicht kann der Strich sich wieder ins Nichts
verlieren.
Eine zufällig aufs Papier gesetzte Linie ist es häufig,
die den Ausgangs-„punkt“ für Martina Küglers Zeichnungen bildet: eine
willkürliche Linie, die nichts als den Willen ausdrückt, sich gegen Chaos und
Leere zu behaupten. „Ich zerstöre erst einmal das Blatt“, kommentierte Martina
den Prozess ihres Zeichnens. Am Anfang steht ein negatorischer Akt: die Negation
des Nichts.
Doch allmählich verdichten sich die Linien zur
Figuration. Aus der anfänglichen Leere steigt eine Gestalt hervor: Ich und
Nicht-Ich sind geschieden. Für die Dauer eines Augenblickes kann die gezeichnete
Figur dem in seiner Einsamkeit schaffenden Künstler ein Gegenüber werden. „Wer
Figuren zeichnet“, so Martina, „dem fehlt das Gegenüber“. Doch wer sich derart
dessen bewusst ist, kann sich nichts vormachen.
Der Kampf gegen den horror vacui ist damit nicht
gewonnen. „Ich wehre mich gegen die Figur“, bemerkte Martina, „indem ich sie
wieder ausstreiche, ausradiere“.
Martinas Figuren kennen keine erstarrten Abgrenzungen.
Figuren überlagern und verdoppeln sich; Körperzonen kippen vom Konkaven ins
Konvexe. Die Geschlechter irritieren, sind nicht auf zwei Pole festgelegt. Innen
und Außen diffundieren beständig; Konturiertes entgrenzt sich wieder. Martinas
Lineatur schreibt keine Demarkationslinien fest: Beinahe kokett spielt sie mit
den Grenzen. Das sich abgrenzende Ich wird, kaum dass es im zeichnerischen
Schöpfungsakt entstanden ist, schon wieder von dem durchdrungen, von dem es sich
abgrenzte.
Ein tastendes Sich-Selbst-Vergewissern, das mit dem
Nicht-Identischen spielt. Entstehen und Auflösen der Gestalt, Individuierung und
Verschmelzung befinden sich in einem gleitenden Kontinuum. Nicht nur am Anfang:
auch am Ende droht das Nichts. Gewichtslos und flüchtig sind die Figurationen;
nichts Festes bindet sie mehr.
Der Betrachter ihrer Blätter bleibt mit dem horror vacui
konfrontiert. Nur wer diesem nicht gewachsen wäre, deckt das Nichts des weißen
Papiers mit handwerklichem Fleiß zu; überzeichnet das Blatt.
Martina Küglers Figuren, die dem undifferenzierten
Nichts entsteigen, sind schwerelos, als hätten sie das Gewicht der Welt
abgeworfen. Sie sind zeitlos, raum- und alterslos, geschlechtslos, - und damit
wieder dem verhaftet, dem sie entrinnen wollen.
Erlösung gibt es nicht: Der himmlische Goldgrund
gotischer Gemälde gerinnt bei ihr zur Materialität bröckelnder gelber Kreide.
Zeichnen ist, wie auch die Musik, eine Zeitkunst: Ihre
Entstehung vollzieht sich in der Dimension der Zeit. Das Musikstück ist
verklungen; die Zeichnung bewahrt die Erinnerungsspur einer verflossenen,
suchenden Bewegung.
Martinas Linien artikulieren sich im Legato, oft aber
auch im heftigen Staccato. Ihr Tempo: Andante ma non troppo, dann wieder ein
Adagio, das sich zum Allegro steigert. Manche Blätter verflüchtigen sich im
pianissimo, andere verschrecken durch ein forte gespieltes Glissando, in dem
wilde Regungen die Stille durchbrechen. Jede Zeichnung hat eine eigene
rhythmische Struktur.
In ihrer Jugend erlernte Martina das Geigenspielen.
Hören wir aus ihren Blättern Bagatellen heraus: leichte Stücke heiteren Inhalts;
oder Capriccios: Kompositionen mit oft wechselnden launigen Themen. Und dann
wieder: dissonante Klänge, Disharmonien, in denen sich eine Urlust am eigenen
Schmerz auszudrücken scheint.
Aisthesis heißt Wahrnehmung.
Martinas Zeichnungen zeigen ein Schauen mit geschlossenen Augen. Der Künstler
ist, wie Dürer sagte,
„inwendig voller Figur“. Für Martina Kügler
sind es keine Figuren, die von außen ins Auge eindringen: Es ist eine
Wahrnehmung nach innen. Ihre inwendigen Figuren, großäugig und nachtwandlerisch,
liegen in dem Kampf, der auch die alten Mythen hervorbrachte. Sie steigen aus
einem inneren Aufruhr hervor, siegen über ihn, indem sie für kurze Zeit zur
reinen Melodie werden, um dann wieder ins Chaos eines ekstatischen Linientaumels
einzugehen.
Die Balance ist stets bedroht. Wenn wir vor ihren
Bildern kurz den Atem anhalten, gar uns irritiert und bedroht fühlen, dann haben
wir sie vielleicht ein wenig verstanden. Denn der Urgrund, aus dem diese Bilder
aufsteigen, ist der gemeinsame Urgrund von uns allen.
In ihrer reinsten, abstraktesten Form führt die Linie
wieder zurück ins Leere, die vor aller Schöpfung war, so wie die Musik, die sich
aus dem Chaos herausschälte, die Tendenz hat, sich wieder in Aufruhr und Tumult
zu verlieren. Wenn sie nicht im unartikulierten Schrei verhallt. Die Negation in
ihrer radikalsten Konsequenz ist – das Nichts.
Was Adorno von den Figuren Becketts sagte, gilt ebenso
auch für die Martina Küglers:
„Diese Stümpfe von Menschen, also diese Menschen, die
eigentlich ihr Ich verloren haben, die sind eben wirklich die Produkte der Welt,
in der wir leben. Es ist nicht der Beckett, der aus irgendwelchen spekulativen
Gründen reduziert; sondern er ist, um es sehr pointiert zu sagen, er ist
realistisch insofern, als er in diesen Gestalten, die zugleich nur noch Stümpfe
und etwas allgemeines sind, der genaue Interpret dessen ist, wozu die einzelnen
Menschen als bloße Funktionen des universalen gesellschaftlichen Zusammenhangs
werden“.
Das unerträgliche Gewicht der Welt höhlt die Individuen
aus. Wie auch Becketts Gestalten, so neigen auch die Martinas zum Verstummen.
Ihre Instabilität gibt einen Ausblick auf die Instabilität der Welt.
„....nur zwei Dinge, die bleiben:
Die Leere und das gezeichnete Ich“. (G.Benn)